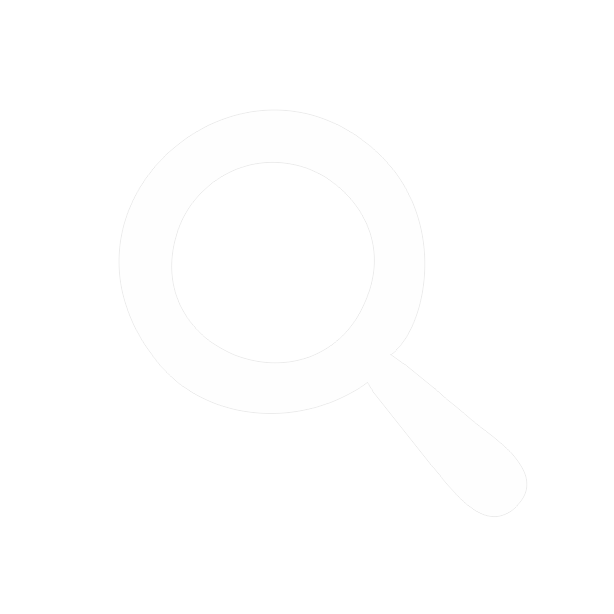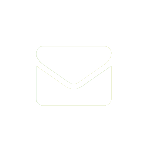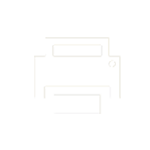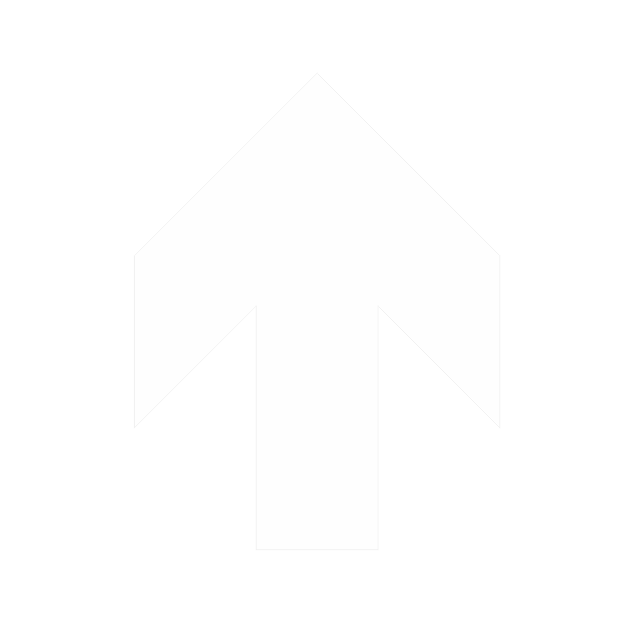Spielhallenwerbung in der verwaltungsgerichtlichen Praxis - Regulierung contra legem (?)
Zur Entscheidung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 13.12.2018
Sebastian Walisko
Freitag, 20.12.2019
Die Regulierung von glücksspielbezogener Werbung stellt eines der zentralen Instrumente zur Erreichung der staatsvertraglichen Ziele dar. Zugleich zeigt sich an ihr aber auch in aller Deutlichkeit, wie sehr die gleichrangigen Ziele des Glücksspielstaatsvertrages miteinander in Konflikt geraten können. Einerseits soll Glücksspielwerbung in ihrer Quantität und Aufmachung beschränkt werden. Der Gesetzgeber verspricht sich von einem Weniger an Werbung eine verringerte Spielteilnahme sowie einen verbesserten Jugendschutz und lässt sich von der Annahme leiten, dass eine zurückhaltende Form der werblichen Anpreisung sicherstellt, dass sich niemand durch reizvolle Versprechungen der Glücksspielanbieter zum Glückspielen verleiten lässt. Andererseits ist Werbung als Kanalisierungsinstrument aber auch dazu im Stande, Glücksspieler oder am Glücksspiel Interessierte zum legalen Spiel zu lenken.
In der Praxis wird diesem Zielkonflikt und dem daraus resultierenden Abwägungserfordernis (scheinbar) nur wenig Beachtung geschenkt. Insbesondere die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zur Zulässigkeit von Spielhallenwerbung belegt einen restriktiven Umgang mit Glücksspielwerbung zugunsten einer auf Spielsuchtbekämpfung sowie Jugend- und Spielerschutz ausgerichteten Regulierung. Dass eine solch einseitige Betonung von Gesetzes wegen nicht gewollt ist, begründet zwar schon die von § 1 GlüStV angeordnete Gleichrangigkeit der staatsvertraglichen Ziele; mangels inhaltlich konkreter und damit vollzugstauglicher(er) Normen bzw. eines „Zu-Ende-Denkens“ der selbst gewählten, mehrdimensionalen Zielprogrammatik durch den Gesetzgeber ist ein Umgehen der eigentlich erforderlichen Abwägung im Einzelfall aber wohl nur schwer zu vermeiden.
Eine Grenze ist dem aus rechtsstaatlichen Gründen aber spätestens dann zu ziehen, wenn die staatsvertraglichen Regelungen überdehnt werden, um sich der von Gesetzes wegen angelegten Abwägungsentscheidung zu entziehen. Vor diesem Hintergrund erscheinen etwa die Ausführungen des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts in seiner Entscheidung vom 13.12.2018, Az. 3 B 128/18, mehr als bedenklich.
Den Ausgangspunkt des Verfahrens bildet die an einen Spielhallenbetreiber gerichtete Versagung einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis wegen Unterschreitung des Mindestabstands zu einer allgemeinbildenden Schule. Bei Vorortkontrollen der zuständigen Ordnungsbehörde fiel auf, dass die Spielhalle trotz Fehlens einer entsprechenden Erlaubnis weiterbetrieben wurde. Daraufhin verfügte die Behörde die Schließung der Spielhalle. Zugleich wurde dem Spielhallenbetreiber aufgetragen, „die Außengestaltung der Spielhalle […] dahingehend zu verändern, dass die Betriebsstätte von außen nicht mehr als Spielhalle zu erkennen sei, insbesondere die Werbung für die Spielhalle an der Außenfassade und die diesbezüglichen Schilder zu entfernen“. Der Spielhallenbetreiber wendete sich gegen die Verfügungen der Ordnungsbehörde und argumentierte im Hinblick auf die Spielhallenwerbung, dass diese auch dann nicht überflüssig werde, wenn an der Betriebsstätte keine Spielhalle mehr betrieben würde, da hierin Dachmarkenwerbung für eine weitere, von ihm betriebene Spielhalle zu sehen sei.
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hingegen stellte die Zulässigkeit der behördlichen Verfügungen fest. Mit Blick auf die angeordnete Entfernung der Werbung führt das Gericht aus, dass „aus dem dem Mindestabstandsgebot […] zugrunde liegenden Schutz Jugendlicher vor Suchtgefahren [folge], dass innerhalb des Mindestabstands nicht nur der Betrieb der Spielhalle selbst, sondern auch eine nach § 26 Abs. 1 GlüStV zulässige Werbung untersagt werden kann“. Es sei erforderlich, „die Schüler einer allgemeinbildenden Schule vor einer Gewöhnung an die ständige Verfügbarkeit des Spielangebots in Gestalt von Spielhallen in ihrem täglichen Lebensumfeld um Bildungs- und Freizeiteinrichtungen zu schützen und einem ‚Reiz des Verbotenen‘ für Minderjährige entgegenzuwirken“. Folgt man der Auffassung des Gerichts, müsste konsequenterweise jegliche Form der Werbung für Spielhallen versagt werden, wenn die konkrete Werbemaßnahme so platziert wird, dass der erforderliche Mindestabstand zu Kinder- und Jugendeinrichtungen nicht mehr gewahrt ist. Auf die Frage, ob die Werbung den staatsvertraglichen bzw. landesrechtlichen Anforderungen für Glücksspielwerbung entspricht, käme es in diesem Fall nicht mehr an. Und mehr noch: Das Sächsische Oberverwaltungsgericht erweitert damit den rechtlichen Anforderungskatalog für Spielhallenwerbung. Die Zulässigkeit entsprechender Werbemaßnahmen würde den Ausführungen des Gerichts zufolge zukünftig zum einen von der Einhaltung gestalterischer Anforderungen und zum anderen von der Wahrung des erforderlichen Mindestabstands zu Kinder- und Jugendeinrichtungen abhängen. Für das Mindestabstandsgebot folgt hieraus zugleich eine Erhöhung seiner Regulierungsintensität in der Weise, als es zukünftig nicht mehr nur der quasi-planerischen Ansiedlungssteuerung von Spielhallen dient, sondern darüber hinaus auch als taugliche Ermächtigungsgrundlage zur Untersagung von Spielhallenwerbung. Der Auffassung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts scheint ein zielorientierter Ansatz zugrunde zu liegen, dem zufolge die Abwehr von Gefahren für Kinder und Jugendliche eine entsprechende „Modifizierung“ des Mindestabstandsgebotes gebiete. Methodisch betrachtet ließe sich die Denkweise des Gerichts wohl wie folgt am treffendsten fassen: Wenn das Mindestabstandsgebot zwecks Schutz von Kindern und Jugendlichen schon die Schließung solcher Spielhallen erlaubt, die mit diesem Ziel in Widerspruch stehen, so müsse dies erst recht für die den eigentlichen Spielhallenbetrieb bloß umrahmende Werbung gelten.
Auch wenn die Feststellungen des Gerichts auf den ersten Blick plausibel erscheinen mögen, offenbaren sich hinter diesen bei näherem Hinsehen gravierende rechtsstaatliche Probleme. So obliegt den Richtern zwar die Auslegung des Rechts, was je nach Umständen des konkreten Falles auch eine Fortbildung des Rechts umfassen kann. Gleichwohl sind auch der richterlichen Gesetzesauslegung und Rechtsfortbildung Grenzen zu ziehen, die sich nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts einerseits aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz und andererseits aus dem Grundsatz der Gesetzesbindung nach Art. 20 Abs. 3 GG ergeben (vgl. BVerfG, Beschl. v. 06.11.2008, Az. 1 BvR 2360/07 = NJW 2009, 499 [500, Rn. 20]). Hinter dieser Grenzziehung steht der Gedanke, dass Gesetzgebung und Rechtsprechung trotz teilweise unumgänglicher Verschränkungen von Verfassungs wegen voneinander getrennte Aufgabenbereiche zugewiesen sind, und eine richterliche Rechtsfortbildung nur solange zulässig ist, wie die Gerichte hierdurch den Gesetzgeber nicht faktisch ersetzen. Kurzum gilt, dass der zur Entscheidung berufene Richter die gesetzgeberische Grundentscheidung respektieren muss.
In Ansehung des zuvor skizzierten Maßstabes dürfte eine Erweiterung des Anforderungskatalogs für Spielhallenwerbung in der vom Sächsischen Oberverwaltungsgericht vorgenommenen Weise nur schwer zu vertreten sein. Mit dem Mindestabstandsgebot bezweckt der Glücksspielgesetzgeber eine ansiedlungssteuernde Reduktion des Spielhallenangebotes, „um das gewerbliche Gewinnspiel auf das Maß von Unterhaltungsspielen und damit als harmloses Zeitvergnügen zurückzuführen“ (LT-Drs. Bay 16/11995, S. 31). Im Unterschied zu diesem quasi-planerischen Regulierungsinstrument wurden die gestalterischen Anforderungen für Spielhallenwerbung gesondert geregelt und als eigenständiges Regulierungsinstrument neben das Mindestabstandsgebot gestellt. Es ist vor diesem Hintergrund nicht ersichtlich, dass der Glücksspielgesetzgeber spielhallenbezogene Werbung zusätzlich zu den gestalterischen Anforderungen ebenso den aus dem Mindestabstandsgebot resultierenden Vorgaben unterwerfen wollte. Richtigerweise hätte das Gericht daher die in Rede stehende Spielhallenwerbung am Maßstab der staatsvertraglichen Vorgaben des § 26 Abs. 1 GlüStV messen müssen – und zwar unabhängig von abstandsbezogenen Erwägungen und unter Abwägung aller staatsvertraglichen Ziele. Dies gilt umso mehr, als auch schon durch § 3 Abs. 3 Satz 4 der Werberichtlinie zum Ausdruck gebracht wird, dass Dachmarkenwerbung grundsätzlich eine zulässige Form der Werbung darstellt.