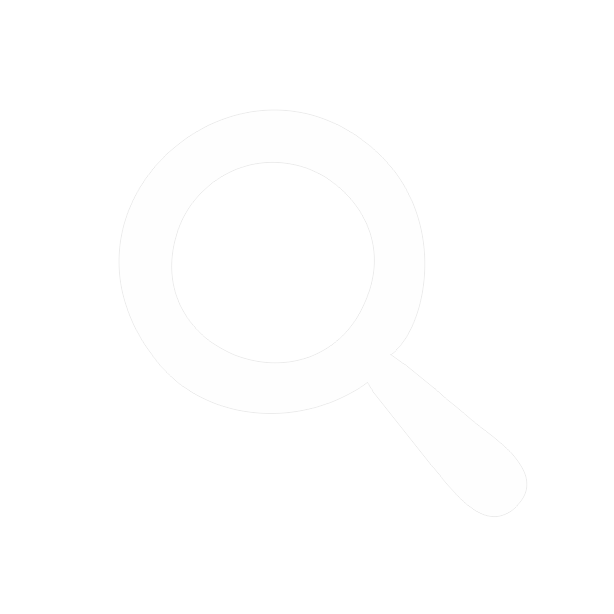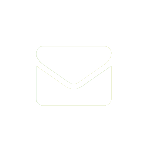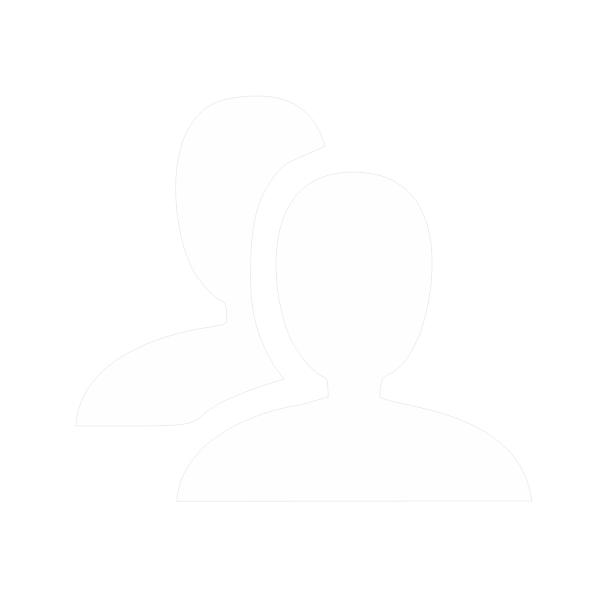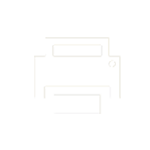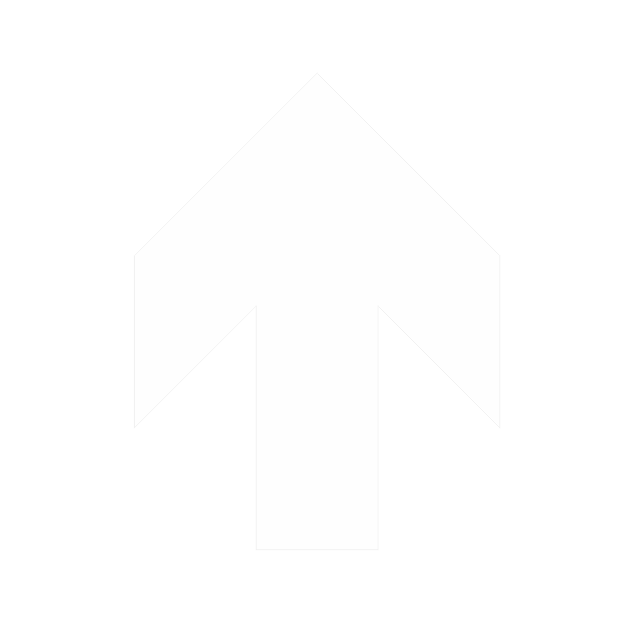Warum junge Männer spielen: Die verborgenen Motive hinter dem Glücksspiel
Prof. Dr. Paweł Ślęczka
Montag, 10.02.2024
Glücksspiel zieht Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen an – für manche ist es ein harmloses Hobby, für andere eine potenzielle Gefahr. Doch was genau treibt junge Männer dazu, regelmäßig zu spielen? Eine Studie von Sleczka et al. (2022) hat vier verschiedene Gruppen identifiziert, die jeweils unterschiedliche Motive haben. Dabei zeigt sich: Während einige das Spielen als Freizeitvergnügen betrachten, birgt es für andere ein erhebliches Risiko.
Vier Typen von Spielern: Wer spielt warum?
Basierend auf einer Befragung von jungen männlichen Spielern in Bayern konnten vier Hauptgruppen mit jeweils eigenen Motiven unterschieden werden:
1. Spaßmotivierte Spieler (59%)
Diese Gruppe spielt vor allem aus Freude am Spiel. Sie genießen den Nervenkitzel, hoffen auf einen Gewinn und sehen Glücksspiel als unterhaltsame Freizeitaktivität. Auch der soziale Aspekt spielt eine Rolle – viele geben an, mit Freunden zu spielen. Das Risiko für problematisches Spielverhalten ist hier am geringsten.
2. Finanziell- und selbstaufwertungsorientierte Spieler (11%)
Hier geht es in erster Linie um Geld und Selbstbestätigung. Diese Spieler sind überzeugt, gut im Glücksspiel zu sein, und setzen darauf, durch Gewinne ihre finanzielle Situation zu verbessern. Im Gegensatz zu den spaßmotivierten Spielern haben sie kaum soziale Motive. Besonders alarmierend: Diese Gruppe hat einen sehr hohen Anteil an Spielern, die bereits Kriterien für eine Spielsucht erfüllen.
3. Adrenalinjunkies (25%)
Für diese Spieler geht es vor allem um den Nervenkitzel. Sie suchen bewusst den Kick und die Aufregung, die das Glücksspiel bietet. Diese Gruppe zeigt eine höhere Impulsivität als die spaßmotivierten Spieler, was sie anfälliger für riskantes und exzessives Spielverhalten macht.
4. Polymotivierte Bewältigungsspieler (5%)
Diese kleine, aber besonders gefährdete Gruppe spielt vor allem, um negative Emotionen zu bewältigen. Sie nutzen Glücksspiel als eine Art Flucht vor Stress oder Sorgen. Diese Art des Spielens ist besonders riskant, da sie eng mit problematischem Glücksspielverhalten verbunden ist. Langfristig haben diese Spieler das höchste Risiko, eine Spielsucht zu entwickeln.
Parallelen zum Pathways Model: Wer ist besonders gefährdet?
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen auffällige Ähnlichkeiten zum bekannten Pathways Model von Blaszczynski und Nower (2002), das drei Hauptpfade zur Glücksspielproblematik beschreibt. Die Spaßmotivierten Spieler entsprechen weitgehend dem verhaltensbedingt konditionierten Typ, der aus Routine oder Gewohnheit spielt und ein vergleichsweise geringes Risiko für eine Glücksspielstörung aufweist. Die Adrenalinjunkies passen in das Muster des impulsivitätsgesteuerten Typs, da sie das Glücksspiel primär als aufregendes, stimulierendes Erlebnis sehen und durch hohe Impulsivität anfälliger für exzessives Spielverhalten sind. Die Polymotivierten Bewältigungsspieler spiegeln den emotional vulnerablen Typ wider, da sie spielen, um negative Emotionen zu regulieren – ein bekannter Risikofaktor für die Entwicklung einer Spielsucht. Eine interessante Ergänzung zum Pathways Model stellt die Gruppe der Finanziell- und selbstaufwertungsorientierten Spieler dar. Diese Variante des verhaltensbedingt konditionierten Typs zeigt, dass finanzielle und egozentrische Motive ebenfalls eine bedeutende Rolle im Glücksspielverhalten spielen. Die motivationsbasierte Klassifikation liefert somit wertvolle Erkenntnisse über Risikogruppen und kann helfen, bestehende Modelle weiterzuentwickeln.
Warum ist das wichtig?
Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass Glücksspiel für verschiedene Spieler unterschiedliche Bedeutungen hat. Während einige es als reines Vergnügen sehen, nutzen andere es gezielt zur Stressbewältigung oder zur finanziellen Selbstverbesserung – oft mit negativen Folgen. Besonders gefährlich ist das Glücksspiel für diejenigen, die es als Bewältigungsstrategie nutzen, da diese Gruppe langfristig das höchste Risiko für eine Spielsucht hat.
Was kann getan werden?
Die Erkenntnisse der Studie legen nahe, dass gezielte Präventionsmaßnahmen notwendig sind, um gefährdete Spieler frühzeitig zu identifizieren. Dazu könnten gehören:
- Aufklärungskampagnen, die auf die verschiedenen Motive des Spielens eingehen und besonders gefährdete Gruppen ansprechen.
- Frühintervention, indem Glücksspielplattformen auffälliges Verhalten erkennen und gezielt Hilfsangebote bereitstellen.
- Psychologische Unterstützung, insbesondere für diejenigen, die spielen, um Stress oder negative Gefühle zu bewältigen. In der Verhaltenstherapie kann das bspw. durch Planung alternativer Hobbys erfolgen.
Fazit: Glücksspiel ist nicht gleich Glücksspiel
Die Forschung zeigt, dass nicht alle Spieler aus denselben Gründen spielen. Während viele das Spielen als harmlose Freizeitbeschäftigung betrachten, nutzen andere es gezielt zur Selbstaufwertung, zur Stressbewältigung oder zur Befriedigung ihres Adrenalinbedarfs. Diese Erkenntnisse liefern wertvolle Ansätze für Prävention und Therapie – und zeigen, dass ein besseres Verständnis der individuellen Motive entscheidend für die Bekämpfung problematischen Glücksspiels ist.
Sleczka, P., Braun-Michl, B., Schwarzkopf, L., Spörrle, M., & Kraus, L. (2022). Why do they gamble and what does it mean? Latent class analysis of gambling motives among young male gamblers. Addiction Research & Theory, 30(6), 431–440. https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2074407